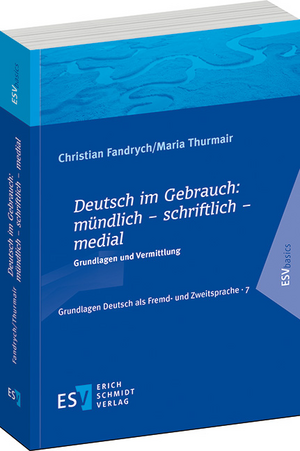„Wir müssen wissen, welche sprachliche Optionen wir in verschiedenen Gesprächssituationen haben“
Liebe Frau Thurmair, lieber Herr Fandrych, ein Gespräch mit unserer Mutter verläuft ganz anders als eines mit unserem Professor. Warum ist das so?
Christian Fandrych / Maria Thurmair: Mit der Mutter – und allgemein mit Familienangehörigen – verbindet uns eine lange und sehr persönliche Beziehung, die von vielfältigen gemeinsamen Erfahrungen geprägt ist, emotionale Spuren hinterlassen hat und unser sehr spezifisches Verhältnis zu ihnen prägt. So unterschiedlich die Beziehungen zur Mutter oder allgemein zu Elternteilen sein mögen – sie sind für Kinder von existenzieller Wichtigkeit. Das bedeutet, dass man in Gesprächen mit der eigenen Mutter einerseits auf einen enorm großen gemeinsamen Wissensschatz zurückgreifen kann – es reichen oft kurze Bemerkungen, um im Gespräch gemeinsame Erfahrungen und die damit verbundenen Einstellungen oder Emotionen aufzurufen. Gleichzeitig handelt man in Gesprächen mit der Mutter auch immer ein bisschen seine eigene Rolle in der Familie (neu) aus, daher können Gespräche auch sehr emotional, persönlich und informell sein.
In einem Gespräch mit einem Professor oder einer Professorin, bei dem oder der man studiert, steht zunächst die institutionelle Rollenverteilung im Mittelpunkt, es geht um fachliche und studienbezogene Fragen, also etwa, ob das Thema der Hausarbeit gut gewählt ist oder welche Aspekte bei der Prüfungsvorbereitung berücksichtigt werden sollten. Auch hier gibt es natürlich formellere und informellere Gesprächssituationen – ein Prüfungsgespräch hat andere Konventionen als ein Gespräch in der Schlange in der Cafeteria. Und neben den fachlichen und organisatorischen Fragen spielen auch persönliche Aspekte eine Rolle: Ich will mich der Professorin oder dem Professor auch gerne als kompetent, interessiert und motiviert präsentieren – das könnte auch ihre bzw. seine Einschätzung und letztlich Bewertung meiner Leistungen beeinflussen. Es kommt also auch hier nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch, wie man sich präsentiert. Generell ist die Distanz zum Professor bzw. zur Professorin also deutlich größer und die Phase, in der man miteinander ins Gespräch kommt (die Studienzeit), deutlich begrenzter als dies in der Familie der Fall ist.
Woher weiß ich, wann ich wie mit wem sprechen sollte? Und was bedeutet das für Lernende des Deutschen?
Christian Fandrych / Maria Thurmair: Da spielen viele Faktoren eine Rolle, die wir im Buch ausführlicher ansprechen. Zum einen gibt es für viele Situationen gewisse gesellschaftliche Konventionen: Welches Verhalten – und welches Sprachverhalten – ist in welcher Situation üblich und angemessen? Das lernt man für viele Gesprächssituationen in der Sozialisation, und so bildet man Routinen aus, auf die man sich verlassen kann und die einem das Handeln erleichtern, die auch die Planung und Durchführung von Gesprächen deutlich entlasten. Zum anderen sind der Kontext, die Rolle der Gesprächspartner und der Zweck des Gesprächs wichtig: Spreche ich als Elternteil, als Schüler/-in, als Antragsteller/-in, und was möchte ich erreichen?
Natürlich spielt dann auch eine Rolle, wie kooperativ sich meine Gesprächspartner verhalten. Im Gespräch geben sie wichtige – sprachliche und nicht-sprachliche – Hinweise darauf, wie groß ihr Interesse am Gespräch ist, welche Emotionen für sie mit dem Gespräch verbunden sind und wie sie die Beziehung zu mir einschätzen. Gerade in informelleren Situationen sind das besonders wichtige Faktoren. Für Lernende, die mit den Gesprächskonventionen und -erwartungen in bestimmten Situationen im L2-Kontext noch nicht vertraut sind, sind also nicht nur die rein sprachlichen (grammatischen, lexikalischen, phonetischen) Kompetenzen wichtig – sie müssen auch die entsprechende Handlungskompetenz in für sie wichtigen Kommunikationsbereichen erwerben.
| Auszug aus: „Deutsch im Gebrauch: mündlich – schriftlich – medial. Grundlagen und Vermittlung" | 09.06.2025 |
| Sprache ist nicht gleich Sprache | |
 |
Im Alltag und im beruflichen Umfeld begegnet uns Sprache in ganz unterschiedlichen Formen. Denn Sprache kann und muss je nach Gesprächskontext auf andere Art und Weise gebraucht werden. Ein Motivationsschreiben ist beispielsweise anders konzipiert als eine Nachrichtensendung. Nichtsdestotrotz fallen beide Kommunikationsformen unter Begriffe wie „Sprache“ oder „Text“. Dies erschwert jedoch eine genaue Definition von Begriffen, wie unterhalb gezeigt wird. mehr … |
Ihr Buch heißt „Deutsch im Gebrauch“. Warum ist dieses Deutsch wichtig im DaF/DaZ-Bereich?
Christian Fandrych / Maria Thurmair: Unser Reden von „einer Sprache“ oder „dem Deutschen“ ist eigentlich immer eine gewisse Verkürzung oder Abstraktion: Wir denken dann an Sprache als eine abstrakte Ressource aus grammatischen Regeln, Wortschatz, Aussprache- und Orthografie-Konventionen. Entscheidend ist aber ja, wie wir davon in ganz konkreten Situationen in angemessener Weise Gebrauch machen. Dafür müssen wir wissen, welche sprachliche Optionen wir in verschiedenen Situationen haben, welche Wirkung diese Optionen haben und welche Konventionen eventuell gelten. Besonders deutlich wird dies vielleicht beim Thema „Siezen“ und „Duzen“: Die grammatischen Regeln dafür sind verhältnismäßig schnell gelernt; wann was angemessen ist – oder wie ich das in einer konkreten Situation evtl. auch erst mit meinen Gesprächspartnern aushandle – ist dagegen viel komplizierter. Häufig zeigt die Wahl der sprachlichen Mittel in einem Text oder Gespräch auch relativ deutlich an, um welche Art von kommunikativem Ereignis es sich handelt, von Verboten und Geboten (wichtig – bitte lesen) über Bewertungen und Kommentare in Gesprächen (seh ich auch so) bis hin zu Wissenschaftstexten mit argumentativer Funktion (Wir gehen davon aus, dass nicht …, sondern vor allem ... Um dies zu untersuchen, führten wir … durch, bei der … vorgestellt wurden). In unserem Buch versuchen wir, diese Zusammenhänge möglichst plastisch und mit vielen Beispielen zu verdeutlichen.
Inwiefern unterscheidet sich Deutsch im Gebrauch im Digitalen und im Schriftlichen?
Christian Fandrych / Maria Thurmair: Natürlich gibt es auch im Digitalen eine Vielfalt von Kommunikationsereignissen mit unterschiedlichen Formen und Funktionen. Dabei sind aber die neuen und meist interaktiven Kommunikationsformen besonders interessant: Sie weisen mehr multimodale Kennzeichen auf, es gibt neue graphostilistische Symbole wie Emojis oder Sticker; das Inventar der schriftlichen (Interpunktions-)Zeichen und der jeweilige Gebrauch ändern sich: Kommas werden wenig(er) verwendet, Punkte oder Ausrufezeichen bekommen eine andere Funktion. Auch im Bereich der Grammatik und des Wortschatzes gibt es Veränderungen beim digitalen, interaktiven Schreiben. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Kommunikation oft informeller ist, aber auch darauf, dass sie oft direkter und fast-synchron abläuft, was Auswirkungen auf Grammatik und Wortschatzgebrauch haben kann. Alle diese Veränderungen stellen wir vor und beschreiben ihr Auftreten und ihre Funktion. Dabei zeigt sich, dass sich auch hier Gebrauchs-Regeln und musterhafte Kommunikationsereignisse herausgebildet haben.
Welche Art von Beispielen meinen Sie, wenn Sie von authentischen und anschaulichen Text- und Gesprächsbeispielen sprechen?
Christian Fandrych / Maria Thurmair: Wir halten es für sehr wichtig, dass die Lernenden und auch die Lehrenden mit den unterschiedlichsten authentischen Kommunikationsbeispielen bekannt gemacht werden, damit sie auf reale Kommunikationssituationen vorbereitet sind. Auch Lehrende sind ja nicht immer aktuell informiert, sei es, weil sie z. B. im Ausland sind und/oder weil sie sich nicht in den entsprechenden Kommunikationsräumen bewegen.
Wir haben bei der Auswahl unserer Beispiele darauf geachtet, dass sie die besprochenen sprachlichen Phänomene und ihre Funktion im Kontext deutlich erkennbar und verstehbar machen, dass sie aber auf der anderen Seite auch für Lernende (und Lehrende) spannend und relevant sind, indem sie etwa an die jeweilige Erfahrungswelt anknüpfen. So finden sich bei den gesprochenen Beispielen neben authentischen informellen Alltagsgesprächen auch z. B. WG-Castings oder Prüfungsgespräche, aber auch Vorlesungen. Die Spannweite im Schriftlichen reicht von literarischen und wissenschaftlichen Texten über Zeitungsartikel bis hin zu Reiseführern oder Kochrezepten (in verschiedenen Variationen). Auch KI-generierte Texte werden punktuell zum Vergleich herangezogen. An manchen Stellen verwenden wir aber auch nachgebildete eigene Beispiele (basierend auf authentischen Vorkommen), wenn wir damit Phänomene besonders anschaulich darstellen können.
In Ihrem Buch findet man zu jedem Thema didaktische Reflexionen. Was können die Leser:innen sich darunter vorstellen?
Christian Fandrych / Maria Thurmair: Die didaktischen Reflexionen sind eine zentrale Säule unseres Buches und unterscheiden es grundlegend von anderen Darstellungen, die das gesprochene oder das geschriebene Deutsch behandeln. Die didaktischen Reflexionen sind als Orientierung für Lehrende und auch Studierende gedacht, sie zeigen, was im gegenwärtigen Sprachgebrauch angemessen ist, wo sich Sprache und Kommunikationsgewohnheiten ändern oder schon geändert haben.
Sie diskutieren aber auch, welche Phänomene für den Spracherwerbsprozess und im Sprachunterricht relevant sind, was Lernende für die verschiedenen Kommunikationskontexte rezeptiv oder produktiv verfügbar haben sollten. Damit ist auch eine kritische Reflexion des Konzepts der Handlungsorientierung verbunden. Unsere didaktischen Reflexionen, die ja durch farbige Unterlegung hervorgehoben sind, sind je nach Thema unterschiedlich umfangreich: Wir gehen auf bekannte Erwerbsprobleme (Konnektoren, Wortstellung, komplexe Strukturen) ein, thematisieren aber auch neue Aspekte (im Mündlichen übliche Assimilationen etwa).
Was ist Ihr ganz persönlicher Tipp zum Sprachenlernen?
Christian Fandrych / Maria Thurmair: Den einen Königsweg gibt es beim Sprachenlernen natürlich nicht, zu unterschiedlich sind Lernende und Zielsetzungen beim Spracherwerb.
Aber was wir immer empfehlen können, ist, jede Form von Kontakt mit der fremden Sprache intensiv zu nutzen: sei es rezeptiv durch Podcasts, Filme, Lektüre, sei es produktiv durch Kommunikation mit L1-Sprecherinnen und -Sprechern, durch Schreiben von Texten und ähnliches. Daneben ist es sicher hilfreich, sich sprachliche Regeln oder auch einzelne Wörter nicht isoliert, sondern mit möglichst vielen guten, auch situativ passenden Beispielen zu merken und immer wieder einzuüben. In den Beispielen stecken die sprachlichen Muster, die man im weiteren Lernprozess dann auch mit anderen Wörtern und in anderen Kontexten ausprobieren kann – so kann man intuitiv Regeln verinnerlichen. Dabei ist es aber auch immer wieder wichtig, dass man für unscheinbare, aber wichtige Aspekte der neuen Sprache sensibilisiert wird – man übersieht und überhört sie sonst oft, weil man sie aufgrund der vorher gelernten Sprachen nicht erwartet. Und man sollte Geduld mit sich selbst und dem eigenen Lernprozess haben – er ist niemals abgeschlossen, es gibt frustrierende, aber auch viele sehr beglückende Phasen und Erfahrungen, die einen für die Mühen des Lernens belohnen.
Vielen Dank für das Interview!
Sie sind neugierig auf das Buch geworden und wollen mehr über die praxisnahe Vermittlung von DaF/DaZ-Inhalten erfahren? Der Titel kann hier bestellt werden.
| Über die Autor:innen |
| Maria Thurmair, Professorin für Deutsch als Fremdsprache an der Universität Regensburg; Breite Publikations- und Forschungstätigkeit im Bereich der Linguistik und Sprachvermittlung DaF/DaZ, (Mit-)Autorin an verschiedenen Grammatiken: Textgrammatik (Weinrich), Grammatik für den Bachelor (Habermann/Diewald/Thurmair), Grammatik für DaF/DaZ (Fandrych/Thurmair), Duden-Grammatik (Wöllstein u.a.); Weitere Monographien im Bereich Textsorten, Modalpartikeln, Vergleiche u.a. Christian Fandrych, Professor für Linguistik Deutsch als Fremdsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig. Publikations- und Forschungstätigkeit im Bereich Linguistik und Sprachvermittlung DaF / DaZ; Chefredakteur der Zeitschrift „Deutsch als Fremdsprache“, u.a. (Ko-)Autor von Monographien zur Wortbildung, zur Rolle der deutschen Sprache in internationalen Studiengängen (Fandrych/Sedlaczek), zur Textgrammatik (Fandrych/Thurmair), zur Grammatik für DaF/DaZ (Fandrych/Thurmair). Autor verschiedener Übungsbücher (Klipp und Klar Lernergrammatik; Fandrych/Tallowitz; Sage und Schreibe Übungswortschatz, Fandrych/Tallowitz). Mitarbeit an Lehrmateralien. Vortragstätigkeit im In- und Ausland |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache