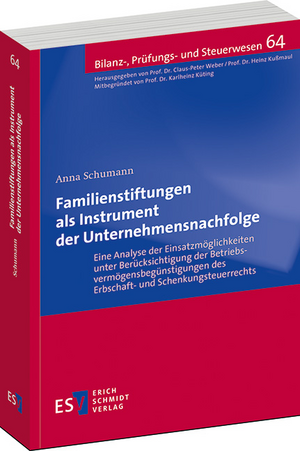Erbauseinandersetzungen mit Immobilien bereiten häufig Probleme (Photo: John Martin / Adobe Stock)
Neues aus der Rechtsprechung des BFH
Steuerfreiheit der Veräußerung von Nachlassvermögen
ESV-Redaktion Steuern
18.01.2024
In einem aktuellen Urteil beschäftigt sich der BFH mit dem Begriff der Anschaffung in Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an einer Erbengemeinschaft und der Veräußerung von Immobilien. Der BFH ändert dabei seine Rechtsauffassung und stellt sich auch gegen die Rechtsmeinung des BMF.
Erbengemeinschaft mit Immobilienbesitz
Im Streitfall war der Steuerpflichtige Mitglied einer aus drei Erben bestehenden Erbengemeinschaft. Zum Vermögen der Erbengemeinschaft gehörten auch Immobilien. Der Steuerpflichtige kaufte die Anteile der beiden Miterben an der Erbengemeinschaft und veräußerte anschließend die Immobilien. Das Finanzamt besteuerte diesen Verkauf gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG als privates Veräußerungsgeschäft (ehemals Spekulationsgeschäft).
Voraussetzungen des privaten Veräußerungsgeschäfts
Der BFH ist dem entgegengetreten. Voraussetzung für die Besteuerung sei nämlich, dass das veräußerte Vermögen zuvor auch angeschafft worden sei. Hierzu seien die Begriffe „Anschaffung“ bzw. „Anschaffungskosten“ im Sinne der § 6 EStG und § 255 Abs. 1 HGB auszulegen.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass nach dem Wortlaut sowie dem Sinn und Zweck des § 23 EStG innerhalb der Veräußerungsfrist realisierte Wertänderungen eines bestimmten Wirtschaftsguts im Privatvermögen des Steuerpflichtigen der Einkommensteuer unterworfen werden sollen.
Nach dem BFH führt der entgeltliche Erwerb eines Anteils an einer gesamthänderischen Beteiligung nicht zur (anteiligen) Anschaffung der Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens. Eine gesamthänderische Beteiligung ist kein Grundstück und auch kein Recht, das den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegt. Eine Gleichstellung ist daher nicht geboten. Daran ändert auch § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO nichts.
Auch aus § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG ergibt sich nichts anderes. Nach dieser Vorschrift gilt die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter. Die Vorschrift erfasst nach ihrem klaren und eindeutigen Wortlaut nur Beteiligungen an Personengesellschaften. Dies schließt eine Anwendung der Regelung auf Erbengemeinschaften aus, da diese nicht zu den Personengesellschaften zählen.
Nach Auffassung des BFH fingiert § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG in seinem (hier nicht eröffneten) Anwendungsbereich den Tatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 EStG, macht damit eine Anwendung von § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO obsolet und bestätigt durch seine Existenz zugleich die in einigen BFH-Urteilen seit 1990 zutage getretene Grundauffassung, wonach die Anschaffung eines Gesellschafts- oder Gemeinschaftsanteils den Tatbestand der Anschaffung eines Wirtschaftsguts nicht erfüllt.
Die Voraussetzungen eines privaten Veräußerungsgeschäfts im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sind nicht gegeben, da keine Nämlichkeit zwischen dem angeschafften und dem veräußerten Wirtschaftsgut besteht.
Mit dieser Entscheidung hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung geändert und ist der Auffassung der Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 14.03.2006, BStBl I 2006, 253, Rz 43) entgegengetreten. Wird eine zum Nachlass einer Erbengemeinschaft gehörende Immobilie veräußert, fällt hierauf keine Einkommensteuer an.
Quelle: BFH, Urteil vom 26.09.2023 -
IX R 13/22, veröffentlicht am 11.01.2024
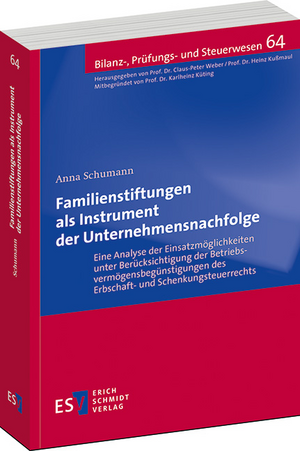 |
Familienstiftungen als Instrument der Unternehmensnachfolge
von Dr. Anna Schumann
Im Zuge der Erbschaftsteuerreform wurde das Verschonungssystem für betriebliches Vermögen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer derart verschärft, dass die Frage, wie die Treiber der Erbschaftsteuerlast beeinflusst werden können, bei der Nachfolgegestaltung von herausragender praktischer Relevanz ist.
Die Eignung der Familienstiftung als mögliches Gestaltungsinstrument der Unternehmensnachfolge – unter Berücksichtigung der spezifischen Betriebsvermögensbegünstigungen des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes – analysiert das Buch von Dr. Anna Schumann. Im Fokus stehen dabei u. a.:
- der zivil- und steuerrechtliche Rechtsrahmen der Familienstiftung, insb. unter Einbezug des ab Juli 2023 neu geltenden Stiftungszivilrechts,
- die Ausgestaltung der Verschonungsregelungen des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts sowie
- die Erbschaftsteueroptimierung durch die Familienstiftung.
Mit vielen Abbildungen und Beispielen werden dabei die Schwachstellen der Verschonungsregelungen aufgezeigt und konkrete Handlungsempfehlungen zum Einsatz der Familienstiftung für die gestaltenden Personen entwickelt.
Das Werk von Dr. Anna Schumann ist mit dem Saarbrücker Förderpreis der Ernst & Young GmbH 2023 prämiert worden.
|
(ESV/cmx)
Programmbereich: Steuerrecht