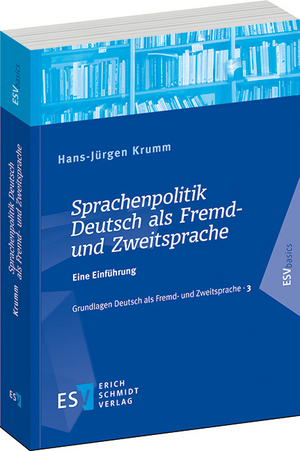Über die Macht deutschsprachiger Sprachenpolitik und die Verantwortung der Forschung
Zur Sprache kommen nicht nur die politischen Interessen an der Verbreitung der deutschen Sprache im Ausland, sondern auch jene sprachenpolitischen Kalküle, die in der Migrationspolitik nicht nur der Integration dienlich sind, sondern ihr zuweilen auch Hürden in den Weg stellen. Dabei versteht sich diese Einführung auch als Mitgestaltung – wie Prof. Dr. Krumm im Interview mit uns erklärt – und formuliert die Einmischung in die Sprachenpolitik Deutschlands, Österreichs und der Schweiz als zentrale Aufgabe des wissenschaftlichen Studiums von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Macht raunt hierbei als Gegenstand der kritischen Analyse immer mit. Lesen Sie zur Machtausübung durch Sprachenpolitik den folgenden Auszug aus Kapitel 5, „Sprache und Macht“:
Zum Verhältnis von Sprache und Macht
„Wäre niemals ein englischer Professor an keiner Universität anzustellen, auch nicht an Akademien; es wäre besser, dass die Sprachen, die in meinen Landen Gang haben, als eine fremde, so gefährliche Sprache wegen religions- und sittenverderblicher Principiis gelehret würde.” Hofdecret Maria Theresias von 1778 (zitiert nach Eder 2006: 73)Mit diesem Hofdekret untersagte Kaiserin Maria Theresia der Universität Wien 1778, eine Professur für Englisch einzurichten. Es ist ein Beispiel für Sprachenpolitik als Instrument der direkten politischen Machtausübung, das zugleich zeigt, dass sich auch eine explizite Sprachenpolitik von impliziten Einstellungen gegenüber Sprachen und ihren Sprechern leiten lassen kann: Im katholischen Österreich waren die vom Papst abgefallenen Engländer, deren Könige es außerdem mit der Unauflöslichkeit der Ehe nicht so genau nahmen, untragbar, ihre Sprache gefährlich und sittenverderblich. Andererseits brauchte es, um ein Vielvölkerreich zu regieren, auch Beamte und Militärs, die die Sprachen der zum Habsburger Reich gehörenden Kronländer wie Böhmisch, Kroatisch, Ungarisch und Polnisch beherrschten (vgl. Ofner 2016). Teilweise wurden in der Armee des damaligen Habsburger Vielvölkerstaates Befehle im Militär in bis zu 12 Sprachen ausgegeben. Insofern sollten nach kaiserlichem Willen auch die Sprachen der zum Habsburger Reich gehörenden Völker („die in meinen Landen Gang haben“) soweit gelernt werden, dass das Land regierbar blieb, Lehrkräfte z.B. in andere Landesteile versetzt werden konnten und das Militär trotz der vielen Sprachen funktionierte (vgl. Eder 2006: 73).
Sprache als Mittel sozialer Kontrolle
Macht wird oft mit Hilfe von Sprache ausgeübt und Sprache wird als Instrument der Festigung von Herrschaft eingesetzt. Um das Verhältnis von Sprachen und Macht zu analysieren, wird häufig die von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu entwickelte Theorie zur Ökonomie des sprachlichen Tausches (Bourdieu 1990) herangezogen. Der sprachliche Markt einer Gesellschaft ist, um mit Bourdieu zu sprechen, durch die Anerkennung einer „legitimen Sprache“ charakterisiert; nur wer sie beherrscht, gehört dazu und hat Teil an den sozialen Macht- und Herrschaftsverhältnissen – Bourdieu bringt dies auf die einprägsame Formel, dass (die legitime) Sprache soziales Kapital auf dem Sprachenmarkt darstellt. Kommunikationsbeziehungen sind in der Regel „auch symbolische Machtbeziehungen [...], in denen sich die Machtverhältnisse zwischen den Sprechern oder ihren jeweiligen sozialen Gruppen aktualisieren“ (Bourdieu 1990:11). Bildungseinrichtungen und Gesetze dienen dazu, die Anerkennung dieser einen Herrschaftssprache durchzusetzen und zu sichern. Im Kolonialismus waren es die Sprachen der Kolonialmächte, die Bestandteil des Herrschaftssystems dieser Mächte waren. Leibowitz (1974: 3) zitiert Antonio de Nebrija, einen spanischen Grammatiker des 15. Jahrhunderts, mit dem Satz „Language was ever the fellow of empire and accompanied it everywhere so that together they waxed strong and flourished and together they later fell“. Im Kolonialismus war Sprache nicht primär Mittel der Kommunikation, sondern zugleich auch Mittel der Exklusion und sozialen Kontrolle. Wer nicht zu den Eroberern gehörte oder sich ihnen nicht anpasste, verfügte nicht über die legitime Sprache und hatte nicht teil an der Macht der Eroberer, sondern wurde ausgegrenzt und diskriminiert.| Im Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm | 05.03.2021 |
| Krumm: „Mein Buch ist ein Blick hinter die Kulissen der Sprachenpolitik“ | |
 |
Wer entscheidet, welche Sprachen wann benutzt und gelernt werden dürfen oder müssen? Weshalb fördern Deutschland und Österreich das Deutschlernen in anderen Ländern und welche Deutschkompetenzen werden von Zuwanderern verlangt? mehr … |
Europäische Geschichte verstehen als Verlust und Wiedergewinnung von Sprachen
Man kann die Diskussion um die sprachlichen Anforderungen an Migrantinnen und Migranten, die Funktion der dominierenden Sprache gegenüber deren Herkunftssprachen auch als Frage der Macht und der Teilhabe an dieser Macht verstehen: Obwohl EU-Bürgerinnen und -Bürger aus Polen oder Portugal kein Deutsch beherrschen müssen, um in Deutschland oder Österreich leben und arbeiten zu können, wird Migranten aus Drittstaaten gegenüber die Beherrschung von Deutsch für Einreise und Aufenthalt abverlangt – unter Machtgesichtspunkten eine Geste der Unterwerfung und Anpassung. Sprachenpolitik dient im Zusammenhang mit dem Aspekt der Macht der Herstellung oder der Aufrechterhaltung von bestimmten Machtverhältnissen: der Macht der Eroberer und Kolonisatoren über die einheimische Bevölkerung, aber eventuell auch der Macht der sozialen und politischen Eliten über andere soziale oder ethnische Gruppen.[…]
In der Tat lässt sich die europäische Geschichte ebenso wie die vieler (ehemaliger) Kolonien auch als Geschichte des Verlustes und der Wiedergewinnung von Sprachen verstehen, wobei Sprachen Instrumente der Unterdrückung sind, aber auch dazu dienen, dass sich die Unterdrückten die Macht zurückholen.
| Zum Autor |
| Hans-Jürgen Krumm, 1975–1993 Professor für Sprachlehrforschung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität Hamburg; 1993–2010 Professor für Deutsch als Fremdsprache an der Universität Wien, sprachenpolitisch aktiv u.a. als Vorsitzender des Beirats Sprache des Goethe-Instituts 1992–2005, als Experte im Europaratsprojekt Linguistic Integration of Adult Migrants (seit 2006) und als Mitglied des österreichischen Netzwerks Sprachenrechte. Ehrenmitglied des Internationalen Verbandes der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. |
(ESV/ff)
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache