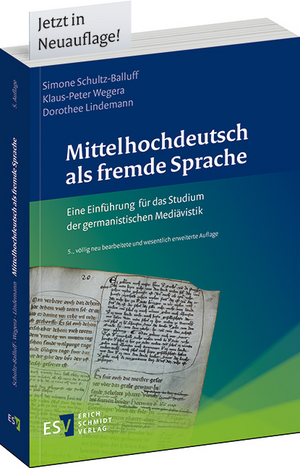„Wir haben uns die Aufgabe gestellt, ein sehr erfolgreiches Buch für die Lehre der germanistischen Mediävistik weiterzuentwickeln.“
Die 5., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage des erfolgreichen Lehrbuchs Mittelhochdeutsch als fremde Sprache ist druckfrisch erschienen. Die neue Auflage hat zahlreiche wesentliche Änderungen aufzuweisen, nicht nur innerhalb des Autorenteams, sondern auch bei Struktur und Inhalt des Lehrbuchs. Bitte erläutern Sie unseren Leserinnen und Lesern, was neu ist und mit welchem Ziel Sie diese Veränderungen vorgenommen haben.
Simone Schultz-Balluff: Wir haben uns die Aufgabe gestellt, ein sehr erfolgreiches Buch für die Lehre weiterzuentwickeln. In ihrer grundsätzlichen Ausrichtung hat die Neubearbeitung einen hohen Wiedererkennungswert – das war allen Beteiligten sehr wichtig. Bildmaterial und Textumfang der Basiswerke wurden jedoch stark erweitert – als Quellen neu hinzugenommen wurden Kulturdenkmäler. Äußerlich ist das Buch nun stringenter aufgebaut, indem jedes Kapitel konsequent zwei Unterkapitel hat. Strukturell haben wir Inhalte einerseits gebündelt und schärfer profiliert, andererseits Ergänzungen vorgenommen.
Dorothee Lindemann: Insgesamt haben wir, auch mit Blick auf die Diversität der Studierenden, mehr auf Progression geachtet. So werden das Übersetzen, der Umgang mit nicht normalisierten Texten, mit Handschriften oder mit Text-Bild-Zusammenhängen in mehreren Kapiteln sukzessive thematisiert und dabei auch unterschiedliche methodische Zugänge gezeigt. Inhaltliches Ziel war es auch, das Buch stärker auf das Selbstverständnis der Mediävistik auszurichten, die sich einerseits als Literatur-, zunehmend aber auch als Objektwissenschaft versteht. Neu ist insofern auch die Vermittlung bzw. Darstellung der Grammatik. Die in dieser Hinsicht vielleicht wichtigste Innovation ist die neue Ablauttabelle, ein einfach zu handhabendes Hilfsmittel, das zu keinen anderen Ergebnissen führt als die etablierte Tabelle, jedoch in kürzester Zeit erklärt und verstanden werden kann. Das schafft Raum für die eigentliche Arbeit: die Auseinandersetzung mit dem Text, die auch über Bilder und Audios befördert wird.
Das Lehrbuch ist in acht große Hauptkapitel mit je zwei Unterkapiteln gegliedert. Was sind die zentralen Themen und wie kann dieses große Angebot in der Lehre am besten eingesetzt werden?
Simone Schultz-Balluff: Die Kapitel setzen einerseits bei den ‚Lebenswelten‘ des Mittelalters an, wie zum Beispiel Hof, Stadt und Wald, und andererseits bei zentralen Themen wie Glaube, Wissen und Liebe. Diese Kapitelthemen rahmen die Text- und Spracharbeit: Über eine eröffnende Seite zu Beginn und eine Sachdarstellung am Ende jedes Unterkapitels werden diese zentralen Themen historisch und kulturell verankert, aber auch sprach- und literarhistorisch vertieft.
Wir machen mit 16 Unterkapiteln in der Tat ein großes Angebot, das heißt man wird je nach Länge des Semesters und Tempo der Lerngruppe auswählen müssen. Grundsätzlich kann ein Unterkapitel pro Woche bearbeitet werden (Tipps hierzu sind in unserem ‚Leitfaden für die Umsetzung im akademischen Unterricht‘ zu finden), dennoch werden nicht alle 16 Unterkapitel in einem Semester in der Präsenzzeit unterrichtet werden können. Grundlegend sind die ersten vier Kapitel (= acht Unterkapitel), sie enthalten gewissermaßen Basiswissen. Mit zwei Haupttexten pro Kapitel kann variiert werden. Die Kapitel 5–7 setzen unterschiedliche Schwerpunkte und können variabel eingesetzt werden (auch in der Reihenfolge). Das achte Kapitel bietet sich zur Klausurvorbereitung an.
Aus dem breiten Angebot kann und soll man sich bedienen: ob Schwabenspiegel, Sachsenspiegel, ‚Bartholomäus‘, ob ‚Nibelungenlied‘, ‚Tristan und Isolde‘, ‚Parzival‘, Walthers Spruchdichtung, Millstätter Genesis, Reimchronik oder Minnesang, ob Codex Manesse oder Gebetbuch, ob Niederdeutsch, Ripuarisch, Bairisch oder Alemannisch – das Lehrbuch ermöglicht mehrere Zugriffsmöglichkeiten und bietet Abwechslung!
Dadurch, dass nicht alle Kapitel Gegenstand des Unterrichts sein können bzw. werden, möchten wir zudem die Studierenden dazu anregen und motivieren, abseits des institutionellen Lesens sozusagen in privater Lektüre weiterzulesen, eigene Interessen zu entdecken und zu verfolgen.
Die neue Auflage reizt nicht nur durch die wunderschöne Bebilderung zur Lektüre, sondern auch durch die Audiobegleitung, mit der die zentralen mittelalterlichen Texte des Lehrbuchs im wahrsten Sinne des Wortes zum Klingen gebracht werden. Welchen didaktischen Ansatz verfolgen Sie damit?
Dorothee Lindemann: Der Ansatz fußt auf der kognitiven Leseforschung. Hörende Menschen können geschriebene Texte nicht verstehen, wenn sie Schrift nicht in ein Hörbild umsetzen können. Oder anders formuliert: Wenn hier Fehler unterlaufen, führt das zu Missverständnissen. Wir alle kennen Prosodiefehler, zum Beispiel aus Kinderspielen wie „Mähen Äbte Heu“. Das ‚Hören vor dem inneren Ohr‘ bildet die Basis für das Verstehen mittelhochdeutscher Texte. Die Audioaufnahmen begleiten die Lernenden außerhalb der Unterrichtssituation, unterstützen den Prozess des Verstehens und tragen dazu bei, die Vorstellung vom Mittelhochdeutschen kognitiv zu festigen und zu verankern. Die Aufnahmen motivieren die Studierenden übrigens auch, sich kreativ mit den mittelhochdeutschen Texten auseinanderzusetzen und zum Beispiel selbst mittelhochdeutsche Texte einzusprechen – oder sie zu vertonen. Auch unter dem Aspekt der Handlungsorientierung sind die Audioaufnahmen also interessant.
| Nachgefragt bei Prof. Dr. Michael Dallapiazza | 26.08.2025 |
| „Wolfram entfacht ein virtuoses Spiel zwischen Erzähler, Erzähltem und Publikum“ | |
 |
Die richtige Frage im richtigen Moment kann oft entscheidend sein. Nicht nur in unseren modernen Zeiten, sondern schon im Mittelalter galt Empathie offenkundig als eine Kunst, die nicht viele beherrschen. „Was fehlt dir?“ — diese Mitleidsfrage hätte Parzival, gleichnamiger Held im Roman Wolframs von Eschenbach, dem kranken Gralskönig Anfortas stellen sollen, um ihn von seinem Leid zu erlösen. Doch Parzival stellt diese Frage zunächst nicht, wird deshalb mit einem Fluch belegt und auf eine lange Reise geschickt, um seine Fehler zu sühnen. mehr … |
Das Lehrbuch beinhaltet neu auch ein herausnehmbares Begleitheft und ein Faltblatt für die Studierenden, die es bislang nicht gab. Bitte erläutern Sie uns kurz den Inhalt.
Dorothee Lindemann: Das Begleitheft besteht aus drei Teilen. Es enthält eine Kurzgrammatik zu Deklination und Konjugation, eine auf starke und besondere Verben fokussierte systematisch-diachrone Darstellung der Verbflexion sowie Grundwissen zu Handschriften (hier werden vor allem Eigenheiten der gotischen Minuskel thematisiert).
Im ersten und dritten Teil bündelt und ergänzt das Begleitheft die Darstellungen des Lehrbuchs, die aus didaktischen Gründen auf mehrere Kapitel verteilt und dort knappgehalten sind. Es enthält unter anderem drei neu konzipierte Verbtabellen.
Der zweite Teil bietet eine systematische Darstellung der mittelhochdeutschen Verbflexion, die diachron perspektiviert wird. Damit sind Lern- und Lehrinteressen angesprochen, die in den entsprechenden Kapiteln bewusst zurückgestellt wurden. Der synchrone Blick auf das Mittelhochdeutsche wird dabei über die Entwicklung zum Neuhochdeutschen perspektiviert. Auch der ‚Blick zurück‘ zu den Anfängen fehlt nicht. Genau das ist für Lernende interessant, weil sie dadurch die Eigenheiten des Mittelhochdeutschen und ihre eigene Sprache einordnen und verstehen lernen.
Das Begleitheft unterstützt sowohl die Vor- als auch die Nachbereitung der einzelnen Kapitel und bietet darüber hinaus eine gute Grundlage für die Arbeit im weiterführenden Studium.
Das Faltblatt bietet die neuen Verbtabellen des Begleithefts und eine Tabelle zu den Pronomina. Es ist als ständige Begleitung für die Arbeit mit mittelhochdeutschen Texten und als Alternative zu den Tabellen im ‚Kleinen mittelhochdeutschen Wörterbuch‘ gedacht. In Bochum ist es deshalb auch zur Klausur zugelassen.
Was war Ihnen besonders wichtig bei der Neustrukturierung der Neuauflage? Wie werden die Dozentinnen und Dozenten, die das Buch in der Lehre einsetzen, bei der Umsetzung in der Praxis unterstützt?
Simone Schultz-Balluff: Es ist uns besonders wichtig, die Gegenstände unseres Faches in ihrer Vielfalt abzubilden und sowohl Sprache als auch Literatur und Kultur einzeln und in ihrem Ineinandergreifen zu zeigen. Wir haben sowohl den in der Lehre gängigen Texten mehr Raum gegeben als auch jene Themen und Textsorten konsequent einbezogen, die überlieferungsbedingt große Teile der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters ausmachen. Die Studierenden sollen auf diese Weise den erweiterten Literaturbegriff des Faches über die praktische Arbeit kennenlernen. In das Lehrbuch sind die damit verbundenen Themen und das Einüben entsprechender Fertigkeiten kontinuierlich eingewoben, wie z.B. der Umgang mit nicht normalisierten Texten und sprachräumlichen Spezifika. Das Lehrbuch soll auf diese Weise eine möglichst breite Grundlage für das weiterführende Studium der germanistischen Mediävistik schaffen.
Für die Unterstützung der Lehrenden bei der Umsetzung des Lehrbuchs in die Praxis haben wir einen ‚Leitfaden für die Umsetzung im akademischen Unterricht‘ erarbeitet. Darin werden der Aufbau der Kapitel und das didaktische Grundkonzept erläutert. Verschiedene Übersichten und strukturelle Erläuterungen sollen den Zugriff auf das Lehrbuch und den Umgang mit den einzelnen Kapiteln erleichtern. Einen besonderen Mehrwert bietet unser ‚didaktischer Durchgang‘ durch die einzelnen Kapitel: Wir erläutern kurz und prägnant die Konzeption und Zielsetzung des jeweiligen Unterkapitels, bieten eine ‚Checkliste Basiswissen‘ und halten sogar Tipps und Impulse zur konkreten Umsetzung bereit.
Unser Ziel ist es, den Lehrenden ein Material zu bieten, mit dem sie möglichst lange unterrichten können und mit dem sie immer wieder neue Facetten des Lehrens entdecken und entwickeln.
Liebe Frau Schultz-Balluff, liebe Frau Lindemann, haben Sie herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Interview!
----------------------------------------------------------------------
Wenn es Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun interessiert, den Band zu lesen und zu erwerben, dann finden Sie alle relevanten Informationen hier.
| Zu den Autorinnen und Autoren |
| Prof. Dr. Simone Schultz-Balluff ist seit 2022 Inhaberin des Lehrstuhls für ‚Geschichte der deutschen Sprache und älteren deutschen Literatur‘ an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u. a. historische Wissens- und Gebrauchsliteratur, Überlieferungsforschung und Editorik, historische Semantik, Mittelniederdeutsch und didaktische Vermittlung historischer Sprachstufen. Prof. Dr. Klaus-Peter Wegera ist seit 2016 Professor im Ruhestand. Sein Forschungsschwerpunkt ist Grammatikographie historischer Sprachstufen in Theorie und Praxis. Dr. Dorothee Lindemann ist Oberstudienrätin im Hochschuldienst an der Ruhr-Universität Bochum. Ihre Forschungsschwerpunkte inkludieren u. a. Übersetzung, Poetik und Syntax des Mittelhochdeutschen, Text und Bild in der Wissens- und Gebrauchsliteratur, Lesedidaktik, höfische Lyrik und den höfischen Roman. |
Programmbereich: Germanistik und Komparatistik