
Zeitgemäßes Fundament für die spanische und lateinamerikanische Literaturwissenschaft
Sex und Gender
In Deutschland ist die „feministische Literaturwissenschaft“ Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts aufgekommen. Wegweisende Arbeiten, auf die sie zurückgreifen konnte, waren Virginia Woolfs Essay A Room of One’s Own (1928) und Simone de Beauvoirs Buch Le deuxième sexe (1949). Erstere veranschaulicht durch die Fiktion einer Schwester William Shakespeares die Möglichkeiten einer Frau als Schriftstellerin, letztere zeigt die historischen und sozialen Bedingungen, unter denen sich das jeweilige Verständnis von Weiblichkeit konstituiert. So zahlreich in literarischen Werken die Bilder der Frau als Naturwesen, als Verkörperung bedrohlicher Sinnlichkeit oder als Idealwesen sind, so selten ist die Frau als aktiv Handelnde in der Literatur- oder Kulturgeschichte repräsentiert. Aus dieser Tatsache wurde die Konsequenz gezogen, die weibliche Kulturtradition aufzuarbeiten, Schriftstellerinnen in unterschiedlichen Epochen aufzufinden und vorzustellen. Während man also auf der einen Seite die Literaturgeschichte um bisher mehr oder weniger vernachlässigte Autorinnen bereicherte, wurden die von männlichen Autoren aufgebauten Frauenbilder als Formen „imaginierter Weiblichkeit“ nicht nur kritisiert, sondern auch hinsichtlich ihrer literarischen Mechanismen, wie z. B. narrativen Strategien oder Subtexten, analysiert. Eine Technik ist dabei das „Gegen-den-Strich-Lesen“, das darin besteht, als Leserin statt wie ein Mann zu lesen und sich dabei gegen die eigenen Interessen mit männlichen Protagonisten und patriarchalischen Denkformen zu identifizieren, vielmehr zugunsten der alternativen weiblichen Kultur eine oppositionelle Lektüre zu betreiben. Insgesamt soll die männlich geprägte und damit einseitige Betrachtung von Literatur ergänzt bzw. ersetzt werden.
Gender
Simone de Beauvoir unterschied zwischen sex und Gender, wobei ersteres sich auf die biologisch anatomische Sicht und letzteres sich auf die gesellschaftliche Seite bezieht, nach der man z. B. nicht als Frau geboren, sondern durch eine patriarchalische Gesellschaft dazu geformt wird. Judith Butler geht darüber hinaus und sieht auch sex als gesellschaftlich konstruiert, da die Vorstellung von der Frau gesellschaftlich vorgeprägt und sex sich als Effekt von Gender erweise. Die Bemühungen und Erfolge des Feminismus in den USA und Europa seit Ende der 1960er-Jahre belegen, dass Unterdrückung und Ungleichbehandlung von Frauen nicht biologisch bedingt, sondern Resultate des Patriarchats sind. Lassen sich entsprechende Unterscheidungen zwischen sex und Gender auch beim Mann vornehmen? Wenn man nicht als Mann geboren, sondern dazu erzogen wird, dann ist auch das „Mannsein“ ein gesellschaftliches Konstrukt. Ersetzt man die medizinische Bipolarität durch gesellschaftliche Konstruktionen, dann ergeben sich unterschiedliche männliche Rollen. Eine Rolle ist nach Raewyn Connell die hegemoniale Männlichkeit, die die Dominanz von Männern und die Unterordnung von Frauen garantiert, eine weitere die Komplizenschaft, die zwar gern an der ersten Rolle festhält, aber auch Kompromisse eingeht. Eine dritte Form ist die Diskriminierung, der z. B. in den USA auch erfolgreiche schwarze Sportler ausgesetzt sind und marginalisiert werden. Viertens schließlich kann homosexuelle Männlichkeit als das Patriarchat schwächend empfunden und untergeordnet werden. Diesen unterschiedlichen Männlichkeiten könnten durch kulturelle Interpretation ebenso viele Weiblichkeiten gegenübergestellt werden. So zeugt ein Frauenkörper von Machtverhältnissen männlicher Verfügungsgewalt, wenn er als übergewichtig, „farbig“, indigen, krank oder alternd dargestellt und marginalisiert wird. (Albert 2024: 7) Den Ästhetiken diverser Körperlichkeit kann man im Theater, im Tanz, in der bildenden Kunst, in Erzählungen und im Kino der spanischen und lateinamerikanischen Gegenwart nachgehen. (Callsen 2023; Schlünder 2020)
| Nachgefragt bei Prof. Dr. Christoph Strosetzki | 22.08.2025 |
| „Im Idealfall soll der Studierende zum Forscher werden“ | |
 |
Die spanische und lateinamerikanische Literaturwissenschaft befindet sich im kontinuierlichen Wandel – neue Forschungsschwerpunkte und -bereiche eröffnen stets neue Zugänge zum Fach. Mit der Forschung und dem Studium verändert sich auch das „Vademecum“ der hispanischen Literaturwissenschaft: So liegt Christoph Strosetzkis Einführungsband nun in dritter Auflage vor. mehr … |
Soziologisch versteht auch Pierre Bourdieu die männliche Dominanz, wenn er sie als Position im Feld der Macht erkennt, die über die Jahrhunderte relativ konstant geblieben ist, aber als kulturell-gesellschaftliches Artefakt prinzipiell veränderbar wäre. Wenn Frauen männlich sein können und sogar männlicher als die Männer selbst, dann ergibt sich nach Judith Halberstam eine weibliche Männlichkeit bzw. eine Männlichkeit ohne Mann, also losgelöst vom anatomischen Männerkörper. (Grünnagel 2018: 33) Als ein Beispiel dafür könnte man die Konquistadorin Inés Suárez anführen, die Protagonistin in Isabel Allendes historischem Roman Inés del alma mía (2006) ist. In Form von Memoiren stellt sie rückblickend ihr Leben, ihre Beziehung zu Pedro de Valdivia, die Hindernisse bei der Eroberung Chiles und die Gründung von Santiago de Chile dar. Dabei wird deutlich, dass Frauen mit männlicher Stärke und Tapferkeit aktiv an der Eroberung beteiligt waren. Durch ihren Erfindungsreichtum bewahrt Inés Suárez eine Soldatentruppe vorm Verdursten, sie vereitelt eine Verschwörung und ist als einzige Frau Mitglied des Kriegsrats. (Rivero 2021: 949) Als weiteres Beispiel ließe sich Teresa von Ávila anführen, die sich im 16. Jahrhundert als starke Frau allen Hindernissen zum Trotz bei ihren Klostergründungen wie eine moderne Unternehmerin immer wieder durchsetzte. Dennoch durfte sie in ihrem autobiografischen Libro de la vida nicht literarische Bildung und schriftstellerische Autorität zur Schau stellen, sondern sie umschrieb das Unsagbare in einem bescheidenen Stil mit Bildern, Vergleichen und Metaphern. Dies fiel ihr leicht, da sie als Mystikerin ohnehin weltliches Wissen ausklammerte und sich für eine „docta y santa ignorancia“ einsetzte. (Egido 2014: 30)
Gender wird also in der Gesellschaft nicht nur durch die Opposition zur Männlichkeit konstituiert, sondern auch durch eine Vielzahl von Verhaltens- und Reaktionsweisen. So kann der Frau die Arbeit im Haus und dem Mann die Arbeit außer Haus zugewiesen sein. Als Beispiel sei das didaktische Werk De institutione feminae christianae (1523) des spanischen Humanisten Juan Luis Vives genannt, das im Gegensatz zu zeitgenössischen italienischen Werken mittelalterlichen Vorstellungen verpflichtet bleibt. So habe sich die junge Frau mit praktischen Aufgaben zu beschäftigen, Kochkunst und Wollspinnen zu erlernen. Das Lateinische solle sie lernen, um sich bei religiösen und antiken Musterautoren sittliche Bildung anzueignen. Um die Keuschheit nicht aufs Spiel zu setzen, solle sie das Haus nur in Begleitung verlassen, überhaupt solle sie Feste und das öffentliche Leben meiden und die Suche des passenden Ehemanns den Eltern überlassen.
Dass die jeweiligen Konstruktionen von Gender geschichtlichem Wandel unterworfen sind, verdeutlicht ein Blick auf den spanischen Roman nach 1975, wo eine anything goes-Haltung, eine Entpolitisierung der Jugend und ein offen zur Schau gestellter Hedonismus in der movida und postmovida nach der transición gegen die Konstruktionen der Geschlechterbeziehungen der Franco-Zeit reagieren. Grenzüberschreitungen begleiten das neue Freiheitsgefühl. Bislang tabuisierte Themen treten in den Vordergrund:
Als Beispiel sei der Bestseller Como ser una mujer y no morir en el intento (1990) von Carmen Rico-Godoy angeführt, der den alltäglichen Kampf der modernen Frau zwischen Beruf, Kindern und Haushalt schildert – ein seit den siebziger Jahren besonders aktuelles Thema, da der erhöhte Bildungsstand die Frauen in großer Zahl auf den Arbeitsmarkt hat streben lassen. Berufstätig nehmen sie gleichermaßen männliche und weibliche Rollen ein, was zur Folge hat, dass der Mann für die Selbstfindung und Definition der Rolle der Frau keine zentrale Bedeutung mehr hat. Eine selbstironische Konstante, die das Scheitern in Kauf nimmt, trägt im Roman immer dazu bei, die Position eines militanten Feminismus zu vermeiden. Eine marxistische Feministin wird zum Gegenstand der Karikatur in Juan Goytisolos La saga de los Marx (1993). In diesem Roman will ein Schriftsteller die Biografie von Karl Marx und seiner Familie schreiben, als im Fernsehen eine Feministin auftritt. Diese leitet ihre Position von einer marxistischen Lehre ab, die Geschlechtergleichstellung durch ökonomische Gleichheit für alle fordert. Die Talkshow parodiert diese frühfeministische These ebenso wie die Gleichheitsforderung mit dem Hinweis auf die Familie des Karl Marx, von der der Biograf zu berichten weiß, dass die Arbeitsteilung dem Hausherrn die intellektuelle Tätigkeit erlaubte, weil sich seine Frau und sein Hausmädchen praktischen Tätigkeiten widmeten.
[…]
Sie sind neugierig, wie es weitergeht? Der Titel kann hier vorbestellt werden.
| Zum Autor |
| Prof. Dr. Christoph Strosetzki ist Professor am Romanischen Seminar der Universität Münster. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Siglo de Oro, Ideengeschichte, spanische und lateinamerikanische Literatur, Philosophie und Literaturtheorie. |
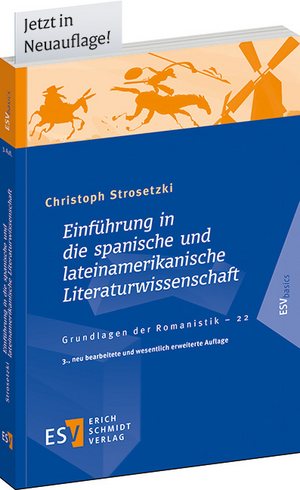 |
Einführung in die spanische und lateinamerikanische Literaturwissenschaft Von Christoph Strosetzki Diese Einführung richtet sich an Studierende der spanischen Philologie – sowohl als Einstieg als auch zur vertiefenden Lektüre. Der vorliegende Band will neugierig machen auf das Fach. Begriffe werden veranschaulicht und Grundkenntnisse in einem studienbegleitenden Vademecum vermittelt. Vorgestellt werden Hilfsmittel wie Semiotik, Rhetorik, Poetik, Hermeneutik und Rezeptionsästhetik. Hinzu kommen Fiktionalität, Autofiktion, Dokufiktion, Ökonomie, Globalisation, Glokalisation, Gender und Heterodoxie. Das Paradigma Raum führt zur Migration, weshalb postmoderne und postkoloniale Perspektiven zu neuen Themen Lateinamerikas führen wie Transkulturation, Hybridität, Postokzidentalismus, Archipelisierung und Gewalt. Spanien ist nicht nur durch den Übergang zur Demokratie („transición“), sondern auch durch die Finanzkrise von 2008, die Coronapandemie, das Platzen der Immobilienblase und die Jugendarbeitslosigkeit geprägt. Der Blick auf Bild und Text, Film und Literatur, Filmanalyse und Medialität zeigt, wie breit das Spektrum hispanistischer Forschung ist. |
Programmbereich: Romanistik
