
„Kultur als diskursiv erzeugte Wissensordnung“
Liebe Frau Zabel, Kultur ist ein weiter Begriff mit vielen unterschiedlichen Definitionen. Was meint Kultur in den Kulturstudien im DaF/DaZ-Bereich?
Rebecca Zabel: In den Kulturstudien gehen wir von einem wissens- und bedeutungsorientierten Kulturbegriff aus. Das heißt, wir interessieren uns für Bedeutungen und dafür, wie geltendes bzw. akzeptables Wissen über die Wirklichkeit hergestellt, ausgehandelt, aber auch – kämpferisch, spielerisch oder ironisch – in Frage gestellt wird. Neben Bezügen zum Konzept der Lebenswelt scheint mir der im Fach zentrale Bezug zu Sprache wichtig. Wir sollten bei der Erforschung von Kultur, d.h. der Herstellung, Aushandlung und In-Frage-Stellung von Wissen und Bedeutung immer danach fragen, wie wir das mittels Sprache tun – und das dann auch bei der Formulierung von Lernzielen kulturbezogenen Sprachunterrichts berücksichtigen.
Handeln nach diskursiv erzeugten Wissensordnungen
Ein Verständnis von Kultur als diskursiv erzeugte Wissensordnung ermöglicht es, auch Sprachenordnungen und darin reproduzierte soziale Zugehörigkeiten bzw. Position(ierung)en in den Blick zu bekommen. Damit haben wir es im Fach ja eigentlich ständig zu tun, z.B. wenn wir Menschen nach ihren Sprachkompetenzen – etwa als B1-Lernende – kategorisieren oder bewerten, oder auch wenn wir Deutsch als ‚fremde‘ Sprache als Lerngegenstand setzen. Letzteres ist konstitutiv für unser Fach.
Solche Wissensordnungen stricken wir – ohne es zu bemerken und auch mehr oder weniger effektiv – mit. Dabei sind wir nicht ganz frei, solche Ordnungen sehen nämlich auch Subjektpositionen vor, an denen wir uns in der Praxis dann oft auch orientieren: z.B. als ‚Mutter‘ oder ‚Vater‘, ‚Veganer*in‘, ‚Fußballfan‘, ‚Deutsche‘, ‚Fremdsprachenlernende‘ zu handeln bzw. zu sprechen. Im Diskurs werden oft auch ‚Migrant*innen‘ spezifische Positionen zugewiesen. Wir sollten aber davon ausgehen, dass wir solchen Ordnungen nicht einfach unterworfen sind. Vielmehr sind wir – mehr oder weniger machtvoll – an ihrer Herstellung beteiligt und wir können sie – auch wieder mehr oder weniger effektiv – in Frage stellen. Auch das gilt es beim Sprachunterricht zu berücksichtigen: Wir sollten Menschen darin unterstützen, an thematischen Diskursen z.B. über Familie, Gender und Geschlechterverhältnisse, Ernährung, Gesundheit, Kleidung und Mode, Nachhaltigkeit, Sport, Nation usw. zu partizipieren – affirmativ, aber auch kritisch – und zwar im sprachlichen Repertoire des Deutschen.
In Ihrem Grundlagenwerk stellen Sie die Geschichte der Kulturstudien im DaF/DaZ-Bereich dar. Was unterscheidet traditionelle Landeskunde von moderneren Ansätzen der Kulturstudien?
Rebecca Zabel: Es ist sicher nicht die ganze Geschichte! Es ist eine Geschichte! Zu Ihrer Frage:
Auch hier ist wieder der Fachkontext wichtig: Bei der Durchsicht v.a. älterer Fachtexte fällt auf, dass Kultur in unserem Fach zwar nicht nur, aber doch auffällig oft dem Teilbereich der ‚Landeskunde‘ zugeordnet wird. In der Landeskunde wird Kultur oft mit einem Land und einer Sprache gleichgesetzt. Ein solch viel zu einfach gedachter Kulturbegriff sieht Menschen – d.h. in unserem Kontext v.a. Lernende des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache – nur als Repräsentanten ihrer ‚Ausgangskultur‘ bzw. ‚Ihres Heimatlandes‘, wie es ja oft in Lehrwerken heißt. Darauf hat immer wieder Claus Altmayer kritisch hingewiesen.
Bisher war es also vorrangig die Landeskunde, die sich für Kultur zuständig fühlte oder zuständig gemacht wurde. Das gilt auch für die kulturwissenschaftliche oder diskursive Landeskunde, in der ich selbst ja auch verortet bin. Die Beschäftigung mit Kultur nur in diesem Teilbereich des Fachs stelle ich im Buch in Frage. Meine These: Kultur in dem wissens- und bedeutungsbezogenen Sinne, wie oben erläutert, ist eine auch für andere Bereiche des Fachs relevante Perspektive. Kulturstudien sollten also nicht mehr nur als Teil oder Weiterentwicklung der Landeskunde begriffen werden, sondern wir sollten sie weiter fassen, d.h. sie als kulturwissenschaftliche Perspektive im Fach insgesamt begreifen. Im Buch gehe ich entsprechend auch auf Grundlagen einer kulturwissenschaftlichen Linguistik im Fach sowie einer kulturwissenschaftlich orientierten Sprachdidaktik ein.
Kulturstudien interessieren sich für das ‚Normale‘ aber auch für Brüche und Widersprüche
Kulturstudien im Fach DaF/DaZ in diesem Sinne interessieren sich für die sprachlich-diskursive Herstellung und Gemachtheit von Welt und Selbst: Im Reden, Schreiben, Erzählen, Argumentieren, Bestreiten, Bewerten sowie etwa beim Erinnern des Vergangenen beteiligen wir uns an der sprachlich-diskursiven Konstruktion von Wirklichkeit. Kulturstudien interessieren sich dabei einerseits für das ‚Normale‘ bzw. das, was wir als Norm setzen und akzeptieren, andererseits fragen Kulturwissenschaftler*innen oft auch nach Brüchen, Widersprüchen und dem, was nicht oder nur am Rande zur Sprache kommt. Gerade auch dieses Interesse am ‚Anderen‘, Widersprüchlichen, Ausgegrenzten, Unsagbaren, den Grenzen des Diskurses kennzeichnet insbesondere einen Zweig der Kulturstudien, der anknüpft an postkoloniale Theorien, die anglo-amerikanischen Cultural Studies sowie v.a. auch poststrukturalistische Differenz-, Zeichen- und Performanztheorien.
| Das könnte Sie auch interessieren: Auszug aus „Kulturstudien im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ | 22.10.2024 |
| Interdisziplinäre Kulturstudien statt traditioneller Landeskunde | |
 |
Grammatik und Vokabeln stimmen – und trotzdem kommt es in Unterhaltungen in Fremdsprachen häufig zu Missverständnissen. Die Relevanz kulturellen Wissens in der Kommunikation ist nicht zu vernachlässigen – Sprachmuster und Routinen, aber auch intertextuelles Wissen sind wichtig, damit unsere Worte Bedeutung erhalten. Die traditionelle Landeskunde, die sowohl Lernende als auch „den deutschsprachigen Raum“ als homogenes Ganzes ansieht, wird nun abgelöst durch neuere Ansätze der Kulturstudien, die diesen Bereich interdisziplinärer begreifen. mehr … |
Nimmt die Relevanz der Kulturstudien im DaF/DaZ-Unterricht in einer sich immer weiter globalisierenden Welt eher zu oder ab?
Rebecca Zabel: Als Kulturwissenschaftlerin halte ich die Kulturstudien bzw. kulturwissenschaftliche Perspektiven im Fach auch in diesem Zusammenhang natürlich für besonders relevant. [Schmunzelt]. Es gibt aber auch gute Gründe dafür. Zunächst sollten wir uns fragen, was wir mit Globalisierung eigentlich meinen. Primär ist damit ja der Prozess des ‚Zusammenwachsens der Welt‘ in wirtschaftlicher Hinsicht angesprochen, also der Waren- und Finanzmärkte, aber auch von Arbeitskraft. Wer am Ende von diesem Austausch profitiert, ist dabei eine ganz wesentliche Frage. Wenn also – um ein Beispiel für unseren Fachkontext zu nennen – das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit der deutschen Bundesagentur für Arbeit und dem kolumbianischen Servicio Público de Empleo mit einem Programm „Fit für den deutschen Arbeitsmarkt“ kostenlose A1 und A2-Kurse anbietet, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass am Ende nicht zuallererst der kolumbianische Staat davon profitiert. Die europäisch-amerikanischen Beziehungen sind nicht mehr so barbarisch wie noch vor ca. 500 Jahren. Aber eine spezifische Form der Ausbeutung bzw. Inbesitznahme von Arbeits- und Fachkraft ist auch mit dieser Form der Zusammenarbeit verbunden. Das Herausarbeiten der diese Praxis ermöglichenden Bedingungen und asymmetrischen Machtverhältnisse ist auch eine Aufgabe für die Kulturstudien in DaF/DaZ.
Wirtschaftlichen und kulturellen Austausch gab es schon vor modernen Globalisierungsprozessen
Mit Globalisierungsprozessen hängen Migration sowie Digitalisierung zusammen, die insgesamt die weltweite Vernetzung von Wissen und kulturellen Praktiken auch über territorial abgegrenzte Räume hinaus ermöglicht. Als Konsequenz dieser Vernetzung wird die Ausbreitung vorrangig ‚westlicher‘ Konsumtrends immer wieder kritisiert. Aber auch Multikulturalismus und Transkulturalität, also die Vermischung und das Durchkreuzen von Kulturen – auch im Sinne von Wissensordnungen bzw. Diskursen – werden als Folge der Globalisierung angesehen. Wir sollten dabei nicht vergessen: Schon bevor wir anfingen über moderne Globalisierungsprozesse und deren Folgen zu sprechen, hat es immer schon wirtschaftlichen und kulturellen Austausch gegeben. Und zwar seit Anbeginn unserer Geschichte als Menschen!
Mit solchen Austauschprozessen einher – und das sehen wir noch stärker seit der Coronapandemie – gehen aber auch Ängste vor ‚Neuem‘, ‚dem Fremden‘, ‚dem Anderen‘ sowie dem Verlust des vermeintlich ‚national Eigenen‘.
Deutungskämpfe über geltendes Wissen und soziale Zugehörigkeiten
Wie diese Ängste u.a. von Rechtspopulisten instrumentalisiert werden, sehen wir derzeit ganz offensichtlich. Auch Rechtspopulisten sind im Übrigen bestens weltweit vernetzt: Siehe die rechtspopulistischen Nationen- und Migrationsdiskurse etwa in den USA, Argentinien, Frankreich, Ungarn, Österreich oder auch Deutschland, die jeweils auch nationale und regionale Symboliken für sich in Anspruch nehmen (so etwa ‚1989‘ im Wahlkampf der AfD), an sich aber doch für recht ähnliche Dinge stehen: sie hassen Vielfalt, bestehen auf national Eigenem und boykottieren oft die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Toleranz. Gegen solche Tendenzen gibt es in all diesen Ländern aber auch Widerstand. ‚Kulturkämpfe‘ – ich meine damit Deutungskämpfe über geltendes Wissen und soziale Zugehörigkeiten – werden auch ‚innerhalb‘ von Gesellschaften oder nationalen Gemeinschaften geführt. So gibt es gegen den Diskurs der Rechtspopulisten auch Protest in der Zivilbevölkerung und den Medien, die für Werte wie Demokratie und gesellschaftliche Vielfalt kämpfen. Vergleichende Diskursanalysen wären hier eine sehr relevante Aufgabe auch für die Kulturstudien in DaF/DaZ.
Mit der Globalisierung einher geht auch die Dominanz bzw. ‚starke Stellung‘ des Englischen, die im Fachdiskurs natürlich – [schmunzelt] – kritisch gesehen wird; ist damit doch auch die Angst vor einer Verdrängung des Deutschen verbunden. Warum wir eigentlich Angst davor haben, kann man sich fragen. Auch das wäre kulturwissenschaftlich interessant. Andererseits ist es ja aber so, dass sehr viele Menschen weltweit auch mehr als nur eine oder zwei Sprachen sprechen. Wichtig ist, dass wir bei der Frage den Fachkontext nicht aus dem Auge verlieren. Das Lehren und Lernen von Deutsch als weiterer Sprache neben bereits erlernten Sprachen ist unser übergeordneter Gegenstand. Wenn es uns aus einer didaktischen Perspektive v.a. darum geht, Menschen darin zu unterstützen, an Diskursen nicht nur mit dem sprachlichen Repertoire bereits erworbener Sprachen zu partizipieren, sondern auch mit sprachlichen Ressourcen des Deutschen, dann ermöglicht das Zugang zu Diskursen, die nicht nur, aber eben auch auf Deutsch geführt werden. Insofern können Deutschlernende ihr sprachliches Repertoire bereichern und dabei etwas über Diskurse und sich selbst darin lernen – z.B. über Ernährungsweisen, Modetrends, Nachhaltigkeitsdiskurse, die Kommerzialisierung des Sports oder auch Genderfragen. Und das – wie gesagt – sprachenübergreifend. Je mehr Sprachen Menschen ‚beherrschen‘, desto besser können sie weltweite thematische Diskurse durchdringen und sich an diesen beteiligen.
Welche Rolle spielt kulturelles Gedächtnis im DaF/DaZ-Unterricht?
Rebecca Zabel: Das kollektive Gedächtnis steht für kulturell-symbolische Überlieferungen von Ereignissen, mit denen sich Menschen in der Gegenwart eine Geschichte (von sich selbst) schaffen. Für die ‚deutsche‘ Geschichte sind das beispielsweise Gedächtnisrahmen, mit denen die Zeit des Nationalsozialismus, ‚Auschwitz‘, oder ‚1989‘ usw. erinnert werden. Auch in diesem Zusammenhang ist wichtig: Wir erinnern kulturell nicht nur, aber insbesondere auch im Medium der Sprache. Jan Assmann hat auf die Bedeutung der Schrift für das kulturelle Gedächtnis hingewiesen.
Das Erinnerungskollektiv ist nicht einheitlich
Wir erinnern uns an Bezugspunkte in der Vergangenheit also in Schrift, Wörtern, Erzählungen, in Literatur und Film, öffentlichen und halböffentlichen Medienbeiträgen, Gottesdiensten, in offiziellen Reden zum Nationalfeiertag, auf Parteiprogrammen usw. Sprache ist also ganz zentral, um Erinnerungen aufrechtzuerhalten, zu vermitteln, weiterzuentwickeln oder mit ihnen zu brechen. Wir sprechen in dem Zusammenhang auch von Erinnerungsdiskursen. Interessant ist auch hier wieder, was solche Gedächtnisrahmen gerade nicht umfassen, was also ausgeschlossen bleibt und die Frage, warum bzw. welche Bedingungen dazu geführt haben, dass etwas nicht vorkommt oder vorkommen soll. Relevant ist auch, dass das Erinnerungskollektiv nicht einheitlich ist. Aleida Assmann hat darauf hingewiesen, dass Individuen unterschiedliche Erinnerungsangebote für ihre Selbstbeschreibungen nutzen können. Aktuell wird vermehrt auch über das Erinnern in der Migrationsgesellschaft nachgedacht. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist etwa der mit dem Deutschen Buchpreis 2023 ausgezeichnete Roman Unser Deutschlandmärchen von Dinçer Güçyeter.
Es geht darum, Lernende mit solchen Erinnerungsrahmen vertraut zu machen
So wie ich es hier geschildert habe – und das war ja Ihre Frage – ist es denn auch relevant für den DaF/DaZ-Unterricht: Es geht darum, Lernende mit solchen Erinnerungsrahmen vertraut zu machen, an Beispielen zu analysieren und zu reflektieren, wie gegenwärtig sprachlich-diskursiv an spezifische Ereignisse erinnert wird, welche unterschiedlichen Gedächtnisrahmen sich ggf. auch gegenüberstehen, und wie das Erinnern insbesondere auch der Schaffung von Gruppenzugehörigkeiten dient. Dies sollte möglichst subjektorientiert geschehen.
| Das könnte Sie auch interessieren: Auszug aus „Fremdsprache Deutsch Heft 71: Kultursensibel unterrichten“ | 24.10.2024 |
| Kultursensibel unterrichten – ein Idealzustand? | |
 |
Die Art, wie wir sprechen, und die Beispiele, die wir nutzen, um grammatische Phänomene zu erklären, spiegeln auch immer eigene Wertevorstellungen und gesellschaftliche Normen wider. Dabei ist es wichtig, sich die Pluralität der Lernenden und deren Erfahrungen bewusst zu machen, um möglichst unproblematisch mit sensiblen Themen umzugehen und den Unterrichtsraum zu einem safe space zu machen. mehr … |
Worauf sollten DaF/DaZ-Lehrkräfte im Umgang mit den Lernenden bzw. in der Vermittlung von Kultur Ihrer Meinung nach ganz besonders achten?
Rebecca Zabel:
1. ‚Die Lernenden‘ gibt es natürlich nicht. Es ist ein Unterschied, ob Sie in der so genannten Vorbereitungsklasse Kinder unterrichten, die ganz spezifische, oft furchtbare Erlebnisse hinter sich haben, Schüler*innen einer DaF-Klasse an einer Schule oder dem Goethe-Institut z.B. in Argentinien, erwachsene Menschen, die einen Integrationskurs oder einen berufsorientierten Deutschkurs in Deutschland oder Österreich absolvieren, Studierende an den Universitäten usw.: alle sind Individuen, die schon viele Erfahrungen im Laufe ihrer kulturellen Sozialisation gemacht haben. Sie wissen oft schon sehr viel über die Welt und haben subjektive Interessen. Diese ernst zu nehmen und zu versuchen, für sie interessante Themen bzw. Diskurse zur Grundlage der Auseinandersetzung zu machen (z.B. zu Familien-, Gender-, Gesundheits-, Nachhaltigkeits-, Fußball-, oder auch Erinnerungsdiskursen) und den Deutschunterricht zumindest ein Stück weit auch danach auszurichten, sollte Ziel der Lehrenden sein.
2. Es geht – auch wenn wir kulturbezogen unterrichten – um das Lehren und Lernen von Sprache. Wir sollten dies in unserem Fach nicht vergessen.3. Bei der Vermittlung von Kultur im Sprachunterricht sollten Lehrkräfte Diskurspartizipation, Diskurspluralität, Diskurskritik als Zielhorizonte setzen und kulturbezogenen Sprachunterricht als Ort für die Ermöglichung von Subjektbildungsprozessen ansehen. Das damit verbundene übergeordnete Lernziel ‚Diskursfähigkeit‘ noch stärker auch empirisch zu fundieren: das ist etwas, womit ich mich gerade beschäftige und es wäre gut, wenn sich möglichst viele an dieser für die kulturdidaktische Dimension im Fach DaF/DaZ wichtigen Aufgabe beteiligen.
Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview!
Rebecca Zabel: Ich danke Ihnen recht herzlich! Auch für die tolle redaktionelle Betreuung in der Endphase beim Schreiben des Buches!
----------------------------------------
Sie sind neugierig und wollen erfahren, was Rebecca Zabel noch zu sagen hat? Hier können Sie ihr Buch bei uns bestellen.
| Über die Autorin: |
| Dr. Rebecca Zabel studierte Kulturwissenschaft, Germanistische Linguistik und Spanisch an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Deutsch als Fremdsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig. Sie arbeitete mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Kulturstudien DaF/DaZ am Herder-Institut, seit 2020 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich DaF/DaZ am Institut für Deutsche Philologie der Universität Greifswald. Ihre Forschungsschwerpunkte sind kulturwissenschaftliche Diskurs-, Subjekt- und Bildungsforschung. |
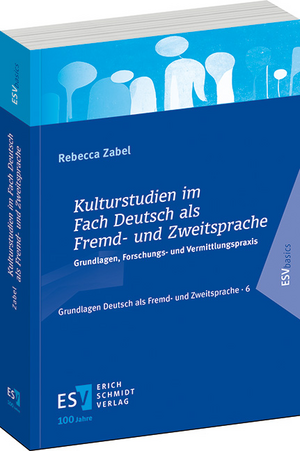 |
Kulturstudien im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache von Rebecca Zabel Die Kulturstudien im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache werden oft noch im Bereich der Landeskunde verortet. Manchmal werden Landeskunde und Kulturstudien sogar gleichgesetzt. Der vorliegende Band begreift Kulturstudien nicht mehr (nur) als einen an die Landeskunde gebundenen Teilbereich des Fachs. Zentrales Anliegen ist vielmehr, Kulturwissenschaft als fächerübergreifende Perspektive im Fach DaF/DaZ zu bestimmen. So thematisiert der Band auch relevante Grundlagen der kulturwissenschaftlichen Linguistik, der soziokulturellen Spracherwerbsforschung sowie der Kultur- und Diskursdidaktik im Fach DaF/DaZ. Der zugrunde gelegte wissenssoziologische Kulturbegriff wird in Vertiefungskapiteln zum kulturellen Erinnern und zu digitalisierten Lebenswelten auch praktisch fundiert. Fokussiert werden Zusammenhänge von Kultur und Sprache sowie Ansätze, die sich mit der Rolle von Kultur bei der Sprachaneignung auseinandersetzen. Anhand ausgewählter Forschungsprojekte wird in kulturwissenschaftliche Forschungsmethoden eingeführt. Konkrete kulturdidaktisch begründete Lehrmaterialien zum Kulturthema ‚Freiheit‘ zeigen schließlich, wie Kultur im Sprachunterricht vermittelt werden kann. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache
