
Sprachen mit Mustern lernen
Gebrauchsbasierte Ansätze in der Sprachvermittlung
Aktuelle Ansätze des Sprachenlernens gehen davon aus, dass Sprache musterhaft aus dem Gebrauch gelernt wird. Dabei werden häufige Wortkombinationen zunächst als Ganzes gespeichert, erst später finden Abstraktionsprozesse statt. Für die Sprachvermittlung folgt daraus, dass der Input eine zentrale Rolle spielt und bewusst gestaltet werden sollte. Zudem gilt es, die Lernenden beim Erkennen von Sprachmustern zu unterstützen und so Abstraktionsprozesse gezielt anzustoßen. Gebrauchsbasierte Ansätze betten die zu lernenden Formen dabei stets in bedeutungsvolle Interaktionen ein.
Sprachlehrpersonen möchten den Unterricht so gestalten, dass die Lernenden ihre Kompetenzen rund um den Gebrauch der deutschen Sprache bestmöglich auf- und ausbauen. Die Gestaltung von Lerngelegenheiten wird von Entscheidungen darüber geprägt, wie viel Raum die Grammatik- und Wortschatzvermittlung einnehmen soll und wie sie mit fertigkeitsbezogenen Übungen verbunden werden kann. Solche Entscheidungen sind auch von den Rahmenbedingungen mitbestimmt. So steht – gerade im Fremdsprachenunterricht – oft nur wenig gemeinsame Lehr- und Lernzeit zur Verfügung. Diese wollen Sie als Lehrende zielführend nutzen, sodass sich die Lernenden die notwendigen sprachlichen Ressourcen aneignen und kommunikativ handlungsfähig werden. Als Grundlage für methodisch-didaktische Empfehlungen dienen aktuelle Erkenntnisse zu Spracherwerbsprozessen unter verschiedenen Bedingungen.
In der Spracherwerbsforschung hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Erkenntnis verdichtet, dass sprachliche Strukturen musterhaft aus dem Gebrauch gelernt werden. Dies spricht grundsätzlich dafür, in der Sprachvermittlung ebenfalls gebrauchsbasierte Prinzipien voranzutreiben:
Ein zentrales Prinzip dabei ist, dass man mit typischen Beispielen beginnt und diese durch Wiederholungen festigt. Erst wenn die Beispiele eingeschliffen sind, werden Abstraktionsprozesse angestoßen, sodass sich Sprachmuster ausbilden. Gebrauchsbasierte Ansätze bringen folglich neue Impulse und setzen bestimmte Akzente, sie sind aber durchaus anschlussfähig an etablierte didaktische Konzeptionen des Sprachenlernens.
| Nachgefragt bei Simone Amorocho und Andrea Ender | 22.04.2025 |
| „Muster helfen uns, schnell und effizient zu kommunizieren“ | |
 |
Wenn wir eine neue Sprache lernen, fällt gerade der Anfang manchmal schwer. Um früh flüssiger zu sprechen, können uns sprachliche Muster und sogenannte Chunks helfen. Wir sprachen hierüber mit Simone Amorocho und Andrea Ender, die die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Fremdsprache Deutsch herausgeben. mehr … |
Gestaltung des Inputs
Wenn man eine Fremdsprache lernt, ist die Zeit, die man dafür aufbringen kann, meist sehr beschränkt. Diese geringe Kontaktzeit stellt einenwesentlichen Unterschied zum Erstspracherwerb dar. Folglich steht Lernenden in einer Fremdsprache deutlich weniger Input zur Verfügung. Nun ist es aus gebrauchsbasierter Sicht aber entscheidend, wie häufig Personen einer Konstruktion begegnen, damit sie sich diese aneignen können. Angesichts dieser ungünstigen Lernbedingungen erscheint es didaktisch geboten, den Input möglichst optimal zu gestalten (vgl. Wong 2005). Das bedeutet, dass die zu erlernende Konstruktion hinreichend häufig vorkommen muss (Kriterium der Frequenz). Neben der Häufigkeit spielt auch die Auffälligkeit einer Konstruktion eine Rolle. Denn je auffälliger eine Konstruktion ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Lernenden sie wahrnehmen (Kriterium der Salienz). So werden Unterschiede zwischen phonetisch ähnlichen Formen (z. B. dem oder den, einen oder ein) von den Lernenden leicht überhört. Dies gilt insbesondere, wenn sie sich darauf konzentrieren, den Inhalt eines Textes oder Gespräches zu verstehen.
Das Frequenzkriterium führt zu der Idee einer Inputflut. Dabei wird die Häufigkeit der Zielkonstruktion in einer Lerneinheit massiv erhöht. Gerade bei weniger frequenten Konstruktionen erscheint diese Form der Inputoptimierung sinnvoll, denn ansonsten müssten die Lernenden große Textmengen rezipieren, bis sie genügend Datenmaterial für Abstraktionsprozesse gesammelt haben. Solche weniger frequenten Konstruktionen spielen auf den höheren Niveaustufen eine größere Rolle als zu Beginn des Sprachenlernens.
Darüber hinaus kommt es aber nicht nur darauf an, wie häufig eine Konstruktion im Input vorkommt, sondern auch darauf, welche Beispiele in welcher Phase des Lernens präsentiert werden. So können Lernende die Bedeutung einer Konstruktion besser erschließen, wenn ihnen in der ersten Lernphase prototypische Beispiele begegnen. Dies sei am Beispiel der Ditransitivkonstruktion veranschaulicht:
Das Verb geben verdeutlicht die Transferbedeutung wesentlich besser als backen. Das liegt daran, dass backen selbst keine Transferbedeutung hat. Vielmehr kommt die Transferbedeutung erst durch den Gebrauch in einer Ditransitivkonstruktion zustande. Die Äußerung Ich gebe dir den Ball kann daher als kognitiver Anker fungieren, um die Konstruktion zu erlernen. Demgegenüber erscheint die Äußerung Petra backt Paula einen Kuchen als Ankerbeispiel wenig geeignet. Tatsächlich kann man für den Erstspracherwerb nachweisen, dass prototypische Vertreter einer Konstruktion im Input der Kinder überproportional häufig vorkommen.
Sind Sie neugierig geworden auf das Heft? Dann können Sie es hier bestellen, als Printausgabe oder eJournal.
| Die Heftherausgeberinnen |
| Simone Amorocho ist Akademische Oberrätin am Institut für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Konstruktionsdidaktik, sprachliche und interaktionale Anforderungen in der beruflichen Bildung, informelles Sprachenlernen und angewandte Gesprächsforschung. Andrea Ender ist Universitätsprofessorin für Germanistische Linguistik mit Schwerpunkt Deutsch als Fremd- und Zweitsprache am Fachbereich Germanistik der Universität Salzburg. Ihre Forschungsgebiete sind Spracherwerb, besonders Deutsch als Zweitsprache, Erwerb von Variation, Sprachvariation in Dialektgebieten, sprachliche Bildung, Mehrsprachigkeit und mentales Lexikon. |
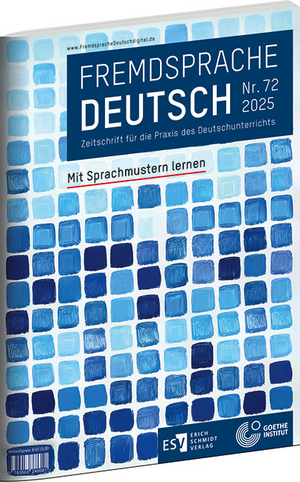 |
Fremdsprache Deutsch Heft 72 (2025): Mit Sprachmustern lernen Heftherausgeberinnen: Simone Amorocho, Andrea Ender Muster zu erkennen und sie produktiv einzusetzen ist zentral für das Erlernen einer Sprache. Deshalb spielen der Input und die Einbettung in bedeutungsvolle Interaktion eine zentrale Rolle. |
Programmbereich: Deutsch als Fremdsprache
