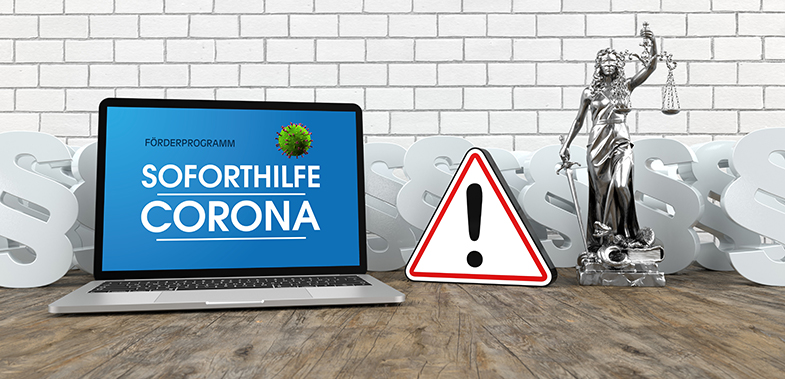
BGH lehnt erneut Entschädigung für Einnahmeausfälle aufgrund von Corona ab
Ab dem 17.03.2020 erließ das Land-Baden Württemberg auf Basis von § 32 i.V.m. § 28 Abs. 1 IfSG mehrere Verordnungen zur Bekämpfung von Corona, die zunächst ein generelles Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen enthielten. Dieses Verbot wurde später bei Einhaltung bestimmter Schutzvorkehrungen und Hygienemaßnahmen gelockert, sodass zunächst wieder Kulturveranstaltungen bei weniger als 100 Teilnehmern gestattet waren. Ab dem 01.07.2020 durften dann Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen und einem vorher festgelegten Programm mit bis zu 250 Teilnehmern stattfinden.
Weil der Kläger mit seiner Musikgruppe aufgrund der benannten Beschränkungen nicht auftreten konnte, verlangte er von dem beklagten Land eine Entschädigung für Einnahmeausfälle in Höhe von 8.326,48 EUR .
| Der kostenlose Newsletter Recht – Hier können Sie sich anmelden! |
| Redaktionelle Meldungen zu neuen Entscheidungen und Rechtsentwicklungen, Interviews und Literaturtipps. |
BGH: Grundrechtseingriffe nicht rechtswidrig
- Grundrechtseingriffe gegeben: Zwar sah der Senat sowohl Eingriffe in Art. 14 GG als auch Eingriffe in Art. 12 GG, weil der Kläger vorübergehend Betriebsmittel nicht oder nur eingeschränkt nutzen durfte und auch seiner beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen konnte.
- Aber – Eingriffe verhältnismäßig: Die Eingriffe hatten aber verfassungsrechtlich den legitimen Zweck, zwischenmenschliche Kontakte zu reduzieren, um die Ausbreitung von Corona zu bremsen. Dies wiederum sollte dem exponentiellen Wachstum der Infektionen entgegenwirken, damit eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden kann und die medizinische Versorgung der Bevölkerung gesichert ist. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) hatte in seinen täglichen Lageberichten gerade die „soziale Distanzierung" als geeignete Gegenmaßnahme zur Verbreitung von Corona bezeichnet.
- Verfassungskonformer Ausgleich: Zudem hatte die öffentliche Hand für den betreffenden Zeitraum einen verfassungskonformen Ausgleich zwischen der Grundrechtsbeeinträchtigung und dem Schutz von besonders bedeutsamen Gemeinwohlinteressen geschaffen. So waren die angeordneten Eingriffe von Beginn an zeitlich befristet. Darüber hinaus hatte der Verordnungsgeber mit seinem stufenweisen Öffnungskonzept nicht nur eine „Ausstiegs-Strategie" im Blick. Vielmehr sorgte er mit seinen Hilfsprogrammen auch für eine weitere Abmilderung der Grundrechtseingriffe. Insoweit betonte der Senat die „Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige“, die das Bundeskabinett am 23.03.2020 beschlossen hatte, die schon ab dem 25.03.2020 März 2020 abrufbar war und in deren Rahmen existenzbedrohte Unternehmen Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten finanzielle Unterstützungen von bis zu 9.000 € erhalten konnten.
- Maßnahmen auch erforderlich: Die Veranstaltungsverbote- und Beschränkungen waren dem Senat zufolge auch erforderlich, denn es standen keine milderen und gleich geeignete Mittel zur Verfügung. Nach weiterer Ansicht des Senats durfte das Land Baden-Württemberg daher im Rahmen seines weiten Beurteilungsspielraums ab Mitte März 2020 davon ausgehen, dass es auf eine schnelle und umfassende Unterbindung sozialer Kontakte ankam, um Corona entgegenzuwirken. Demgegenüber wären Verhaltensregeln für Versammlungen und Veranstaltungen auch bei voller Beachtung kein gleich wirksames Mittel gewesen, so der Senat hierzu.
- Eingriffe in Art. 5 GG: Auch soweit die angeordneten Veranstaltungsverbote als Eingriffe in Art. 5 GG anzusehen sind, gilt das Gleiche wie bei Art. 12 GG, führt der Senat weiter aus. Die Kunstfreiheit ist nämlich dort, wo es um den Ausgleich von Erwerbsschäden geht, nur in ihrer vermögensrechtlichen Dimension betroffen und nicht in ihren immateriellen Belangen.
- Keine Verpflichtung zur Regelung von Ausgleichsansprüchen: Schließlich musste der Gesetzgeber des IfSG verfassungsrechtlich keine Ausgleichsansprüche für die streitgegenständlichen Beschränkungen schaffen. Insoweit betonte der Senat, dass das Veranstaltungsverbot nur zweieinhalb Monate dauerte. Unter Einbeziehung des Unternehmerrisikos, das Gewerbetreibende stets zu tragen haben, hielt der Senat den benannten Zeitraum für zumutbar.
 |
|
| Verlagsprogramm | Weitere Nachrichten aus dem Bereich Recht |
| Passend zum Thema | 12.05.2023 |
| BGH zu Ausgleichsansprüchen aufgrund von Betriebsstilllegungen im Corona-Lockdown bei Frisörgeschäft | |
 |
Haftet der Staat für Einnahmeausfälle von Frisörgeschäften, die durch die vorübergehende Schließung von Betrieben im Frühjahr 2020 zur Bekämpfung von Corona entstanden sind? Hierüber hat der III. Zivilsenat des BGH aktuell entschieden. mehr … |
| Mehr Rechtsprechung | 26.05.2023 |
| Gerichtsentscheidungen rund um Corona | |
 |
Corona hat nicht nur dazu geführt, dass der Gesetzgeber und die Behörden existenzielle Bürgerrechte eingeschränkt haben. Auch das Zivil-und Arbeitsrecht ist betroffen, was die Gerichte noch immer beschäftigt. An dieser Stelle fassen wir fortlaufend – je nach Aktualität – eine Auswahl von wichtigen Gerichtsentscheidungen zusammen, die Corona betreffen und über die wir berichtet haben. mehr … |
(ESV/bp)
Programmbereich: Staats- und Verfassungsrecht
